|
Die Nicht-Nachhaltigkeit unserer Lebensweise ist nicht zu rechtfertigen", sagt Autor Fred Luks. Hoffnung sollte dennoch bestehen bleiben - und zwar als alternative Einstellung zu naivem Optimismus und lähmendem Pessimismus. Fred Luks im Interview über sein neues Buch Hoffnung! Lieber Herr Luks – Ihr neues Buch heißt Hoffnung. Hoffnung als durchaus kluge, kritische, skeptische Einstellung zu unserer momentanen, sehr ernsten Lage weltweit. Hoffnung als Alternative zu naivem Optimismus und destruktivem Pessimismus. Was genau ist mit dieser ernsten Lage gemeint? Geht es uns global gesehen nicht besser denn je? Luks: Wenn man sagt, es gehe „uns“ gut, würde ich nachfragen, wer genau „wir“ sind. Aber es ist gewiss so, dass es weltweit einen historisch einmaligen materiellen Wohlstand gibt. Auch im globalen Süden hat sich in den letzten Jahren einiges getan – wobei man nicht die überragende Bedeutung des chinesischen Wachstums übersehen sollte. Das Grundproblem betrifft aber alle: dass das derzeitige Wohlstandsmodell nicht nachhaltig ist. Bekanntlich bräuchten wir mehrere Planeten, wollten alle auf dem materiellen Niveau einer durchschnittlichen US-Amerikanerin leben. Unser Wohlstand ist nicht „enkeltauglich“ – die Welt wirtschaftet heute auf Kosten kommender Generationen. Um das zu ändern, braucht man Hoffnung. Denn Pessimismus ist faul, weil das schlechte Ende als unausweichlich gesehen wird. Das ist eine unproduktive Einstellung. Sehr produktiv ist allerdings auch der Optimismus nicht. Der Optimist glaubt daran, dass sozusagen „automatisch“ alles gut wird. Wenn angesichts der aktuellen Krisen manche Menschen glauben, dass die Dinge sich jetzt gut richten werden, bremst genau diese passive Einstellung womöglich eine Wende zum Besseren. Deshalb erfordert die Lage keinen Optimismus, sondern echte Hoffnung. Ein Zitat von Stephan Lessenich: "Wir leben nicht über unsere Verhältnisse. Wir leben über die Verhältnisse der anderen." Unsere westliche, "imperiale" Lebensweise ist laut ihrem Buch nur möglich, weil wir einem Großteil der restlichen Welt genau diese Lebensführung verunmöglichen und auf deren Ressourcen zurückgreifen. Gleichzeitig ist dieses tiefgreifende Bedürfnis nach Wohlstand und Sicherheit auch Vorbild für Milliarden von Menschen in Schwellen- und Entwicklungsländern. Dass sich ein solcher Lebensstil für alle nicht ausgeht, scheint mittlerweile klar. Wie sind solche Privilegien überhaupt noch rechtfertigbar? Luks: Die Nicht-Nachhaltigkeit unserer Lebensweise ist nicht zu rechtfertigen. Mittlerweile bekennt sich ja praktisch jeder Staat zu Nachhaltigkeit und damit zur Generationengerechtigkeit. Mit den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen gibt es einen sehr unvollkommenen, aber doch relevanten „Fahrplan“, dem die Welt folgen kann. Würde dieser Zielekatalog wirklich ernst genommen werden, könnten sich Gesellschaften zumindest in die richtige Richtung bewegen. Langfristig würde damit auch Lessenichs Diagnose nicht mehr stimmen. Das wäre dann sicher eine bessere Welt als die, mit der wir es heute zu tun haben. Hoffnung steht in Ihrem Buch auch für einen gestalterischen, anstatt einem erlittenen Wandel. Durch aktive Problemlösungsversuche könnten Transformationsprozesse – wie zum Beispiel der Klimawandel – zumindest möglichst positiv mitgestaltet werden. Natürlich gibt es unzählige Bemühungen und Initiativen, aber auch eine um sich greifende Ohnmacht und ein Festhalten an alten Strukturen, die offensichtlich nicht zukunftsfähig sind. Wieso ist Erdulden für viele einfacher als Mitgestalten? Fehlt es hier an partizipativen Ansätzen? Ich teile nicht den Partizipationsoptimismus vieler Nachhaltigkeitsengagierter. Die repräsentative Demokratie hat aus meiner Sicht unschlagbare Vorteile, die wir nicht leichtfertig aufs Spiel setzen sollten. Qualitäten wie Fachkompetenz, das Ringen um gute Lösungen und Entscheidungsfähigkeit sind auch für Ziele wie Nachhaltigkeit und Klimaschutz unabdingbar. Gleichzeitig schließen sich die Vorzüge repräsentativer Prozesse und eine Ausweitung partizipativer Prozesse grundsätzlich natürlich nicht aus. Mehr Partizipation wird es nicht schaffen, Gewohnheit und Bequemlichkeit aus der Welt zu schaffen – aber man darf doch die Hoffnung haben, dass mehr Möglichkeiten zum Mitreden und Mittun sich positiv auf die Motivation auswirken würden, sich aktiv an gesellschaftlichen Aufgaben wie Klimaschutz zu beteiligen. Wenn echte Gestaltungsmöglichkeiten erlebt werden, würde das der Nachhaltigkeit guttun – und ganz sicher auch der Demokratie. Eine gewisse Form der Mitwirkung findet übrigens zunehmend auch in der Wirtschaft statt. Immer mehr Unternehmen sehen, dass sie ihr Umfeld kennen müssen, um langfristig erfolgreich zu sein. Deshalb ist „Stakeholder“ heute so ein wichtiges Wort, wenn es um Nachhaltigkeit und die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen (CSR) geht. Wirtschaftlicher Erfolg hängt heutzutage auch davon ab, Stakeholdern wie Kundinnen, Mitarbeitern und Nichtregierungsorganisationen zuzuhören. Gleichzeitig kritisieren Sie den sogenannten Nachhaltigkeitspopulismus als ein naives, schwarz-weißes Geschäftsmodell. Wie soll sich Max Mustermann also verhalten – zwischen dem Druck, aktiv (und hoffnungsvoll) für eine bessere Zukunft zu kämpfen, aber ja nicht in die Populismus-Falle zu geraten? Zu den wenigen positiven Seiten der Corona-Pandemie gehört ja eine klare Erkenntnis: Wenn’s ernst wird, stehen Populisten mit leeren Händen da. Für die komplexen Probleme unserer Welt gibt es keine einfachen Lösungen – das gilt für Gesundheitsfragen ebenso, wie für die Wirtschaftspolitik oder die Klimaerwärmung.  Ich halte es für wichtig, die Herausforderungen nicht zu individualisieren, sondern immer den gesellschaftlichen Kontext zu sehen. Die genannten Felder sind gesellschaftlicher Natur – und müssen entsprechend gesellschaftlich und politisch bearbeitet werden. Für Einzelpersonen heißt das aus meiner Sicht: sich der eigenen Verantwortung bewusst sein und entsprechend handeln – aber auch die Grenzen dieser Verantwortung sehen. Verantwortung trage ich für das, was ich auch beeinflussen kann. Wenn man das übersieht, droht leicht Überforderung und Frustration. Das hat sicher etwas mit dem Begriff „Lebenskonzepte“ zu tun. Ich halte es für wichtig, stets die politische Natur der aktuellen Krisen im Blick zu behalten. Ein Lebenskonzept, dass die Verantwortung für den Zustand der Welt bei einzelnen Menschen verortet, ist ein Rezept zum Unglücklichsein. Ich halte es für „nachhaltiger“, die Grenzen der Verantwortung zu sehen, an dieser Erkenntnis sein Handeln und Engagement auszurichten. Damit steigen die Chancen, dass man Tierleid mindert, den Klimaschutz fördert und im Sinne einer nachhaltigen Zukunft wirkt. 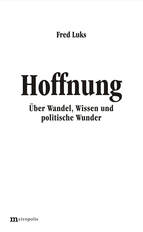 Buchtipp: Titel: „Hoffnung - Über Wandel, Wissen und politische Wunder" Autor: Fred Luks Umfang: 146 Seiten Erschienen bei: Metropolis Verlag Fotos: A few lovely things; Arnaud Pyvka; Matheus Bertelli, Daniel Xavier/Pexel; Paddy-O-Sullivan, Caroline Hernandez, Bernhard Hermant/Unsplash Interview: Sarah Langoth
2 Comments
11/28/2020 13:10:00
dieses Interwiev hat mich ein wenig sicherer gemacht in meinen Überlegungen,wie ich wohl ,als alter Mensch mit 87 , einen Beitrag leiten kann in der allgemein schwierigen Lage. Schon lange ohne Auto , aber mit Spül und Waschmaschine ….
Reply
Albert
6/20/2024 20:57:26
A short biography of Fred Luks would be helpful. What expertise does the gentleman have? The fact that he teaches does not attribute to him any competence. That doesn't come to light in this interview either. Where does the view that hope brings more than optimism come from? Both attitudes are not mutually exclusive, but they do not require a plan or energy and do not require even a minimal understanding of connections. The “climate gluers” also have hope!
Reply
Leave a Reply. |
|







