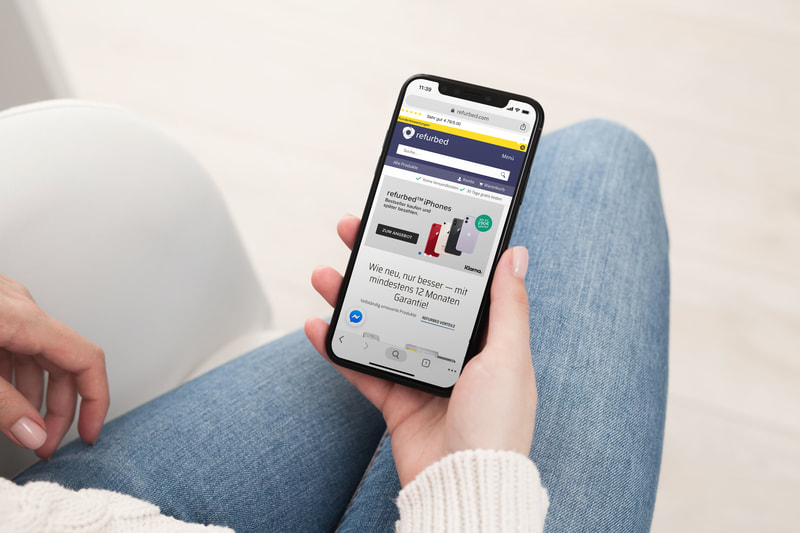|
Ökologisch, langlebig, lokal. Lehm hat viele Vorteile – und ist überall auf der Welt zu Hause, nicht nur im globalen Süden, betont Lehmpionier Martin Rauch. Besonders in Kombination mit Holz oder Beton erweist sich der Naturbaustoff als (klima-)stark und zukunftsweisend… „Lehm ist das sozialste Baumaterial überhaupt“, sagt Martin Rauch. Seit 1985 konzipiert, plant und realisiert der gebürtige Vorarlberger Lehmbauprojekte auf der ganzen Welt. Vielfach wurden diese Projekte ausgezeichnet und in Zusammenarbeit mit Star-Architekten umgesetzt. „Man kann damit sowohl „lowtech“ nur mit der Hand, als auch „hightech“ gute, aufwendige Gebäude bauen“, skizziert Rauch die enorme Einsatz-Bandbreite. Ist Lehm der Baustoff der Zukunft? „Erde pur“, so lässt sich schlicht und einfach Lehm umschreiben. Ein Drittel aller Menschen weltweit lebt in Häusern, die ganz oder teilweise mit Lehm gebaut sind. Und das nicht nur in Westafrika oder im Nahen Osten, sondern auch Mitten in Europa. So wohnen alleine in Deutschland rund zwei Millionen Menschen in Häusern, die zum Teil mit Lehm ausgekleidet sind. Die Vorteile liegen auf der Hand – oder vielmehr vor Ort in der Erde: Lehm punktet durch sehr gute Temperatur- und Feuchteausgleichswirkung, geringen Energiebedarf und Schadstofffreiheit! In Zeiten weltweiten Rohstoffmangels, der Energiekrise und Unsicherheiten auf den globalen Märkten, erweist sich der „lokale Naturbaustoff“ als besonders vorteilhaft. Ob als Aushubmaterial beim Bau einer Tiefgarage oder vermeintlicher „Abfall“ bei Gebäudeabriss oder auf Deponien: Das natürliche Baumaterial ist im großen Umfang lokal verfügbar und kann so eingebaut werden, dass es stets wiederverwendbar ist – Stichwort: Kreislaufwirtschaft. Zudem gilt Lehm als wetterunabhängig und terminlich genau kalkulierbar. Ohne lange Transportwege, was wiederum die Arbeitszeit auf der Baustelle verkürzt. „Lehm ist sicher“, entgegen mancher Unkenrufe! „Gestampfter Lehm ist massiv und tragfähig, seine Dichte entsprecht der von Beton“, sagt Lehmexperte Rauch (Foto links), der auch als Honorarprofessor des UNESCO-Lehrstuhls „Earthen Architecture“ tätig ist. Die Wasserlöslichkeit, vor der man beim Lehm Angst hat, ist vielmehr seine Stärke, so Rauch. „Lehm besitzt die Fähigkeit sehr schnell Feuchtigkeit aufzunehmen, aber auch wieder abzugeben“. Mit Modulen und Systembauweisen lassen sich mehrstöckige Wohn- und Firmengebäude relativ einfach zusammenfügen. Und hier gebe es noch viel Potenzial – beispielsweise bei Schulen, Kirchen, Parkanlagen, aber auch bei Lärmschutzwänden. „Ein guter Lehmbau hält Hunderte von Jahren“, ist Lehmbauexperte Martin Rauch überzeugt. Und auch wenn die Nachfrage global gesehen derzeit noch eher gering ist, steigt die Nachfrage merklich. Die vielen nachhaltigen Eigenschaften werden von immer mehr Bauherren, Baustoffherstellern und Baufirmen eingefordert. Neben den ökologischen und klimatischen Vorteilen, sind es auch die puristische, minimalistische Ästhetik, die den Lehm attraktiv macht. Wände aus heimischer Erde, die angenehm kühlen und wärmen? Ohne hohen Energieaufwand, Kosten und langen Lieferwegen? Die Zukunft des Bauens liegt vor uns - in der Erde…  Lehmhaus-Konstruktion in Burkina Faso >> 3-D-Animation https://www.nationalgeographic.com/magazine/graphics/burkina-faso-mud-house-architecture-3d-model-feature Web-Tipp: www.lehmtonerde.at/de Quellen & Info-Links: National Geographic Cradle-Mag.de Fotos: AHA / Foto Bruno Helbling (Titel); Ricola Kräuterzentrum; Schulpavillon Allenmoos; ORF; Tinkhauser Wohnhaus /Norman Müller Text: Helmut Wolf
0 Comments
Mut machen! Barrieren in Köpfen und am Arbeitsmarkt abbauen. Gregor Demblin, Gründer der sozialen Unternehmensberatung myAbility, gilt als unermüdlicher Kämpfer einer inklusiven Unternehmens- und Lebenskultur. Ein Interview! Herr Demblin, was sagen sie Menschen, wenn Sie die Aussage „Das geht ja nicht“ hören? Ich höre ständig, was alles nicht möglich ist und nicht geht. Sei es von Taxifahrern, dass der Rollstuhl nicht in den Kofferraum passt, oder was alles am Flughafen nicht funktioniert. Mittlerweile bin ich sogar schon so weit, dass ich den Satz gar nicht mehr ernst nehme. Oder sogar als Ansporn sehe. Ich habe schon so viele Dinge gemacht, von denen alle glaubten, dass sie nicht gehen werden – so war das bisher auch bei all meinen Unternehmungen. Meinen Kindern sage ich immer, lasst euch nie von irgendjemandem einreden, dass irgendwas nicht gehen wird. Man muss es zumindest einmal versuchen, bevor man sagt, dass etwas nicht geht. Die Welt befindet sich seit einigen Jahren in einer Reihe von Krisen und steht vor großen Herausforderungen. Was würden sie Menschen raten, um besser mit Unsicherheit und Veränderungen umgehen zu können? Ich würde den Menschen sagen, dass das ganze Leben eine ständige Veränderung ist, und dass es eigentlich nichts gibt, was dauerhaft gleichbleibt. Man muss sich an den Gedanken gewöhnen, dass wir uns von der Geburt bis zum Tod ständig verändern, sich alles rundherum verändert und immer verändern wird. Genau dieser Fluss ist ja auch eine der Grundweisheiten in jeder philosophischen Strömung. Manchmal sind Veränderungen stärker, manchmal weniger stark wahrnehmbar, manchmal auf einer globalen und manchmal auf einer sehr individuellen Ebene, aber Unsicherheit und Veränderung ist das, was unser Leben ausmacht. Ich glaube das Wichtigste ist, dass man vor Veränderungen keine Angst hat. Veränderung heißt nicht automatisch, dass alles schlechter wird. Veränderung heißt, dass etwas Neues entsteht und etwas Neues kann ja auch etwas sehr Gutes sein. In jeder Veränderung liegen riesige Chancen. Und genau diese Chancen muss man sehen - nicht die Ängste. Die jüngste Geschichte hat gezeigt, dass nach schwierigen Zeiten neue, positive gesellschaftliche Entwicklungen entstehen können. Was sind ihrer Meinung nach die (bisherigen) Lehren aus Pandemie, Energieknappheit und Klimaveränderungen? Ich bin ein großer Optimist. Ich glaube, die Menschheit hat es ganz oft geschafft, Probleme in letzter Sekunde zu lösen. Ich will die Klimaveränderungen überhaupt nicht kleinreden – das sind riesige Herausforderungen, vor denen wir hier stehen. Aber ich glaube daran, dass es den Menschen auch hier gelingen wird, Lösungen zu finden. Ich hoffe, dass die Pandemie die Menschen auch ein bisschen wachgerüttelt hat und gezeigt hat, dass man oft sehr schnell handeln muss und die Dinge nicht immer nach hinten verschieben kann. Das ist in der Pandemie, im Falle der Impfung, sehr gut gelungen. Genau solche vereinten Anstrengungen braucht es auch beim Thema Klima und ich hoffe, dass die Menschen das rechtzeitig verstehen werden. Wirtschaft, Konsum, Mobilität, Digitalisierung und Arbeitsmarkt – wir stehen vor massiven Umwälzungen. Wenn Sie eine Prognose wagen würden, wie glauben Sie wird sich unsere Welt in 20 Jahren darstellen?
So eine Prognose wäre unseriös. Ich glaube, dass die Digitalisierung der Trend ist, der sich am allerstärksten auswirken wird. Wir stehen jedenfalls noch ganz am Anfang. Alle Unternehmen sind dabei, unglaublich viele Daten zu sammeln, aber die wenigsten wissen wirklich, was sie mit diesen Daten anfangen und wie sie sie verwerten können. Das ist auch das Kernthema von dem, was wir bei „tech2people“ machen. Ich glaube, es wird große Veränderungen geben – so wie es diese immer gegeben hat. Ich freue mich sehr auf die nächsten 20 Jahre. Und ich hoffe, dass unsere Welt eine sehr grüne Welt sein wird und wir ein anderes Thema diskutieren als das Thema Energieknappheit. Haben Sie ein bestimmtes Ziel, dass sie anstreben? Ich habe immer viel zu viele Ziele gleichzeitig (lacht). Woraus schöpfen sie Kraft und Lebensfreude? Die größte Lebensfreude schöpfe ich aus meinen Kindern und daraus, zu sehen, wie sie groß werden und wie sie die Welt sehen. Was ich ständig an positiver Energie von ihnen geschenkt bekomme – das ist unschätzbar. Neben meiner Familie schöpfe ich auch sehr viel Lebenskraft aus der Natur - ich liebe das Meer, den Wald und die Berge. Und ich liebe meinem Beruf. Einen Beruf zu haben, der einen erfüllt, kann sehr viel Kraft und Lebensfreude schenken. Ich habe dieses Privileg. Auch große Ziele, die ich mir stecke und irgendwann erreiche, motivieren mich jeden Tag. Was ist ihr Lebenskonzept? Ich versuche, mir immer darüber bewusst zu sein, wie unendlich kurz die Zeit ist, die uns gegeben wurde. Jeden Tag als Geschenk wahrzunehmen und den Wert zu sehen, der uns in jedem einzelnen Augenblick geschenkt wird. Vielen Dank für das Gespräch! Web-Tipps: www.myability.org www.tech2people.at Fotos: Achim Bieniek, Point of View, Tech2people, Florian Wieser/myAbility Interview: Helmut Wolf Konsum neu denken und leben. Unternehmen mit „allen realen“ Umweltkosten besteuern. Peter Windischhofer, Co-Gründer des Online-Marktplatzes „Refurbed“, zeigt sich im nachfolgenden Interview überzeugt, dass Europa Vorreiter und Vorbild beim nachhaltigen Wirtschaften und Klimaschutz werden kann und muss… Herr Windischhofer, das bisherige Mantra lautet: Wirtschaftliches Wachstum, um (fasst) jeden Preis. Die weltweite Klimakrise und vielen sozialen Konflikte zeigen, dass stetiges Wachstum zu einem globalen Ungleichgewicht geführt hat. Welche Mechanismen und Regeln bräuchte es Ihrer Meinung nach, um ein nachhaltiges Wirtschaftssystem etablieren zu können? Ein Teil der Antwort liegt bereits in der Formulierung: „Wirtschaftliches Wachstum um jeden Preis“ wäre aus meiner Sicht nicht das Problem gewesen, wenn es so tatsächlich stattgefunden hätte. Aber genau nach diesem Prinzip haben wir eben in den letzten 50 Jahren nicht gewirtschaftet: Wäre der Preis das oberste Entscheidungs-Prinzip in unserer Wirtschaft gewesen, hätten Unternehmen in die Gesamtrechnung auch Ressourcenverbrauch, Entsorgungskosten, CO2- Ausstoß und andere Umweltaspekte „einpreisen“ müssen. Denn all das hat einen Preis, auch wenn er nicht auf einem Zettel mit Umsatzsteuer daherkommt. Genau das ist aber in den letzten Jahrzehnten nicht passiert. Was braucht es also, um ein nachhaltiges Wirtschaftssystem aufzubauen? Zuerst die Erkenntnis (und auch das Erleben), dass unsere Art des bisherigen Konsums uns selbst „teuer zu stehen“ kommt. Dann kann jeder und jede Einzelne anfangen sich die Frage zu stellen: Wenn das der Preis ist – brauche/will ich das wirklich? Und dann braucht es natürlich auch Veränderungen auf politischer und struktureller Ebene. Es müssen Anreize für Unternehmen geschaffen werden Nachhaltigkeit in der Unternehmenskultur zu verankern - und nicht einfach als „Greenwashing“ auf die Marketing-Agenda zu setzen. Auch Rechtssicherheit für Großinvestitionen in Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Aspekt. Oder eine Rechtslage, die Reparatur als Recht der Konsumenten verankert. Wir sind daher auch Teil eines Experten-Konsortiums zum Thema „Kreislaufwirtschaft der europäischen Union“. Diese Initiative wird vom Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss (EESC) in Brüssel unterstützt und trägt zur „European Circular Economy Stakeholder Platform“ (ECESP) bei. Zuviel Konsum = zu viel Ressourcenverbrauch. Wie glauben Sie, lassen sich bisherige, ressourcenverschwendende Gewohnheiten in der Gesellschaft ändern? Für den oder die Einzelne ist es wichtig, dass es einfacher und kostengünstiger wird, nachhaltig zu leben. „Einfacher“ im Sinne von Verfügbarkeit und Sicherheit, „günstiger“ im Sinne der Kostenersparnis. Das ist sicher auch einer der Hauptgründe, warum wir mit unserem Online-Marktplatz und der Idee des „Refurbishments“* seit 2017 so stark wachsen: Viele Menschen wollen nachhaltig kaufen, denken aber noch immer, dass dies „teurer“ bedeutet. Bei uns erleben sie, dass sie z.B. neuwertige Elektronik nachhaltig kaufen können, mit 1 Jahr Garantie und einer Kostenersparnis bis zu 40 Prozent. Dieses Erleben führt dazu, dass wir unter unseren Kunden viele „Wiederholungstäter“ haben. Viele EU-Ländern sind heute sehr wohlhabend. Jener Wohlstand, der auch durch fossile Energieträger und einen verschwenderischen Lebensstil gewonnen wurde. Wie müssen sich die wohlhabenden, europäischen Länder und die EU zukünftig positionieren – gerade auch im Hinblick auf die Vorbildwirkung für Schwellenländer in Afrika oder Asien? Europa steht eigentlich vor einer großen Chance: Während wir bei vielen rasant wachsenden Wirtschaftsmärkten, wie bei der Künstlichen Intelligenz oder der Chip-Produktion, meist hinter den USA und China „hinterherhinken“, ist die Klimatechnologie ein Markt, in dem Europa nicht nur aktuell führend ist, sondern auch das Potenzial hat, dies auch langfristig zu bleiben. Daher muss Europa Vorreiter beim Klimaschutz werden, damit sich dies nicht nur positiv auf das Klima auswirkt, sondern auch auf Europas Wirtschaft. Dies wäre auch für die Schwellenländer ein wichtiges Signal in Richtung: Wirtschaftliche Stärke durch Innovation und Nachhaltigkeit.…  Die Pandemie, der Krieg in der Ukraine, die Energiekrise, extreme Umweltereignisse... "Braucht" es Krisen und extreme Situationen damit Menschen ihr Verhalten überdenken? Ich weiß nicht, ob man sagen kann, wir „brauchen“ Krisen. Fakt ist: Wir haben sie - und sie werden wohl eher mehr als weniger werden. Und: wir werden diese Krisen immer haben. Die Frage ist aber: Was sind wir bereit aus ihnen zu lernen? Wenn wir uns auf das Neue einlassen und auch neue Fragestellungen zulassen, die daraus entstehen, kann letztendlich das Ergebnis einer Krise positiv, befriedigend und sinnvoll sein. Das funktioniert aber nur, wenn man durch die Krise durchgeht und nicht daran vorbei. Das betrifft Einzelpersonen genauso, wie Unternehmen und Staaten. Ein nachhaltiger Lebensstil wird zumeist mit Einschränkung und weniger Komfort assoziiert. Welche positiven Anreize könnten bei den Menschen wirken? Aus Unternehmersicht würde ich sagen: Leichtere Verfügbarkeit, die Sicherheit, hochwertige Produkte zu kaufen, Rückgaberecht, Garantien – und dabei Preisersparnis bei allen nachhaltig produzierten oder erneuerten Produkten. All das, was wir aus der „Fast Consumption“ kennen, muss sich mittelfristig auch bei nachhaltigen Produkten am Markt etablieren. Wichtig ist aber auch, dass die Politik steuerliche Anreize schafft, also zum Beispiel die Umsatzsteuer auf nachhaltige Produkte senkt, oder Dienstleistungen und Produkte, die wir als „Klimasünder“ kennen, teurer macht. So muss beispielsweise Fliegen einfach mehr kosten als Zugfahren. Reparieren, Teilen/Sharen, im Kreislauf wirtschaften... Wie sieht ihrer Meinung nach ein ideales soziales und umweltgerechtes Wirtschaften und Handeln in Zukunft aus? Genauso: Reduce – also weglassen, was nicht nötig ist. Reuse – reparieren, refurbishen, verschenken, weiterverkaufen… Recycle – was wirklich nicht mehr verwendet werden kann, so entsorgen, dass es möglichst wenig Impact erzeugt. Ach ja – und beim Kauf schon den Recycling-Aspekt mitbedenken. Der Wandel fängt bei jedem Einzelnen an. Welche Veränderung war für Sie in den vergangenen 5 Jahren die schwierigste bei der Umsetzung? Ich habe mein Reiseverhalten sehr stark geändert. Früher bin ich beruflich und privat viel geflogen. Mittlerweile versuche ich, das so stark wie möglich einzuschränken. Jetzt fliege ich nur mehr, wenn es keine Alternative gibt und kompensiere das entstandene CO² zumindest. Meistens nehme ich jedoch den Zug oder reise gar nicht und plane meine Meetings online. Urlaub mache ich meistens mit dem E-Auto im europäischen Ausland. Was würden Sie - ganz generell - sofort ändern, wenn Sie es könnten? Ich würde Ressourcenverbrauch und den CO2-Ausstoss global massiv besteuern, um endlich die realen Kosten richtig zu verteilen. Was ist ihr persönliches Lebenskonzept? Überlege dir, wo du wirksam sein kannst und dann steh‘ auf und tu es. Vielen Dank für das sehr interessante Gespräch! Web-Tipp: www.refurbed.com Info *Refurbishing bezeichnet die qualitätsgesicherte Überholung und Instandsetzung von Produkten zum Zweck der Wiederverwendung und -vermarktung. Unter anderem für Smartphones, Tablets, Monitore, Software, Drucker, Kopiergeräte, Toner- und Tintenkartuschen usw. Aber auch bei Komponenten aus Kraftfahrzeugen, Produktionsmaschinen und ganzen Produktionsstraßen trägt Refurbishing zur Vermeidung von Abfällen und Schonung von Primärressourcen bei. Fotos: Unsplash, Pexels, Refurbed Interview: Helmut Wolf Tonnenweise Obst und Gemüse „retten"? Und daraus köstliche Marmelade, Sirup, Chutneys und Eingelegtes kreiren? „Unverschwendet“ nennt sich das vorbildhafte Projekt gegen Lebensmittelverschwendung von Cornelia und Andreas Diesenreiter. Ein Gespräch über anfängliche Skepsis und nachhaltigen Erfolg... „Selbstständigkeit und die Verwirklichung neuer Ideen stößt immer auch auf Skepsis“, sagt Cornelia Diesenreiter. Gerade wenn es um etwas Neues geht, dass es in dieser Form bisher noch nicht gegeben hat. Als sie gemeinsam mit ihrem Bruder Andreas 2015 das Projekt „Unverschwendet“ ins Leben gerufen hat, gab es so gut wie keine Jobs im Bereich Lebensmittelabfallvermeidung. „Unbändiger Glaube an der Sache". „Mir blieb sozusagen nichts anderes übrig, als gemeinsam mit meinem Bruder Andreas ‚Unverschwendet‘ zu gründen“, sagt Diesenreiter. Für diese Entscheidung sei sie heute noch jeden Tag dankbar, wie sie betont. Und auch wenn ihrer Idee am Anfang Skepsis entgegengebracht wurde, und viele meinten, dass „sich das wirtschaftlich niemals ausgehen wird“, so waren sie und ihr Bruder stets vom „unbändigen Glauben an der Sache“ überzeugt. Der Erfolg gibt den beiden jedenfalls Recht. Lebensmittelabfallvermeidung ist heute zu einem zentralen Thema geworden. Und mit der Philosophie des Unverschwendet-Teams, hat man genau das richtige „Rezept“ dafür gefunden. Nämlich: Überschüssiges Obst und Gemüse in köstliche Produkte, wie Marmelade, Sirup, Chutneys, Eingelegtes, Süß-Saures, Ketchup, Saucen und vieles mehr, umzusetzen. „Wenn man tonnenweise Obst und Gemüse rettet, wenn man gemeinsam mit den Landwirtinnen am Feld die Wunder der Natur beobachtet oder die Menschen in unseren Laden kommen und sich dafür bedanken, dass es uns gibt, dann wissen wir, dass wir das Richtige tun“, sagt Cornelia Diesenreiter. Man kann ihr nur zustimmen...
Web-Tipp: www.unverschwendet.at Fotos: Unverschwendet Text: Helmut Wolf Der Text ist auch in der „Freude“-Ausgabe 18 von Sonnentor erschienen. |